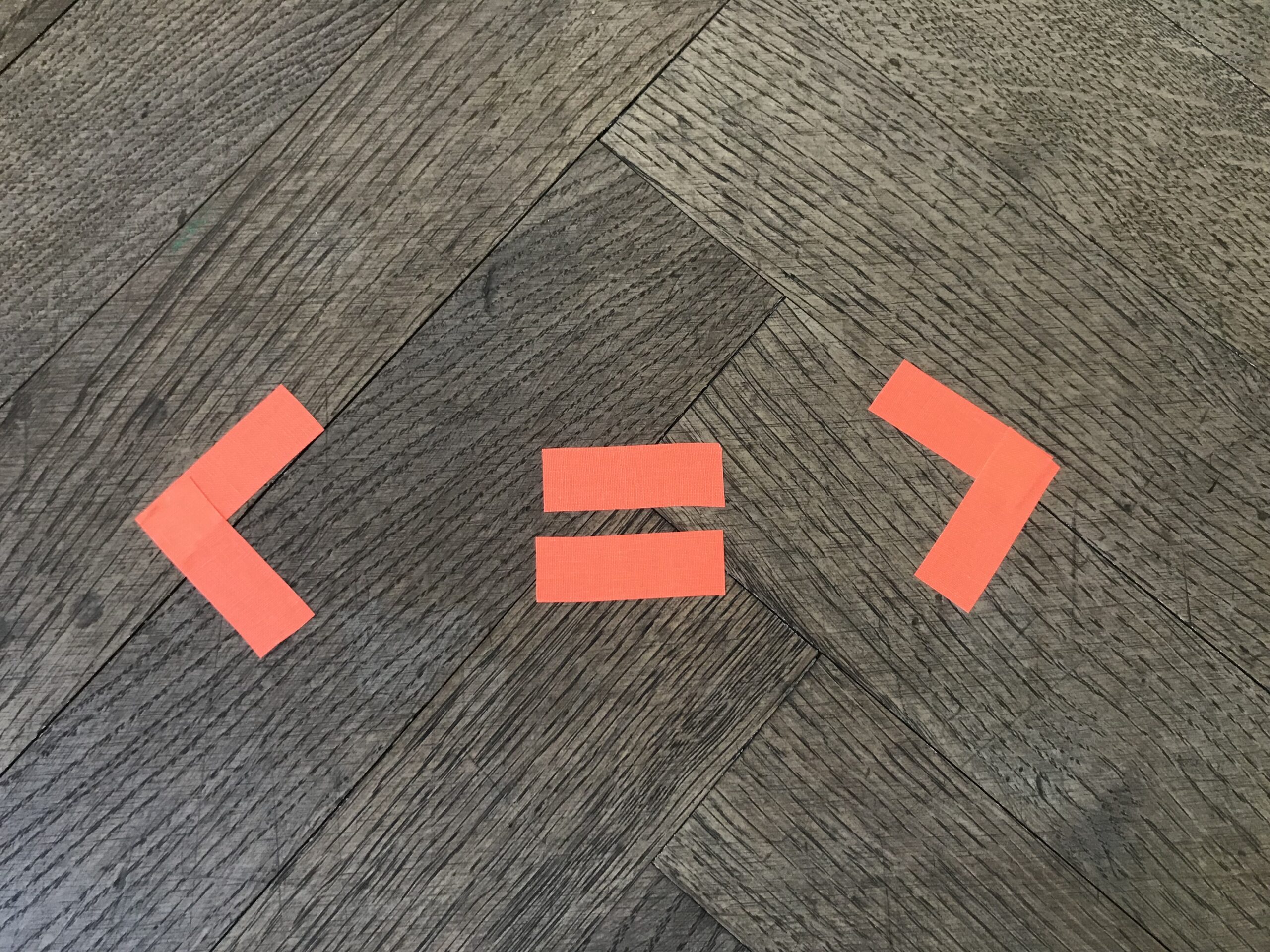Privilegierter Verzicht?
Die letzte Zeit hat uns vor Augen geführt, wie wenig wir im Grunde für gegeben nehmen können und dass es möglich ist, relativ schnell in eine Situation des unfreiwilligen Verzichts gebracht zu werden. Ob uns aktuell die Preisentwicklung zu einem reduzierten Konsumverhalten zwingt, die Corona-Pandemie unser Sozialleben einschränkt oder uns die Vorboten der Klimakrise ganz allgemein zu einem anderen Lebenswandel raten.
Weniger ist mehr als Ansatz entwickelt sich zunehmend von einer eher abgedroschenen Phrase zu einer notwendigen Haltung. Aber man sollte auch vorsichtig sein, nicht die Realität zu verleugnen. Die Mathematik der Formel weniger ist mehr funktioniert oft, ja, aber sie muss ausbalanciert sein. Manche Menschen mögen aus absoluter Askese so etwas wie Freude ziehen können; sie sind jedoch die Minderheit.
Die Krux am Verhältnis zwischen Verzicht und Privileg lässt sich an einem Wort festmachen: Wahl. Wenn ich mir aussuchen kann, worauf (und wie lange) ich verzichte, bin ich privilegiert. Gehe ich für einige Wochen mit einem latenten Hungergefühl zu Bett, um meine „Pandemiewampe“ loszuwerden, ist das eine privilegierte Position. Sollten Lust und Laune für die Diät verloren gehen (oder der Beachbody endlich da sein) kann ich meinem Körper sofort all die kulinarischen Perversionen zuführen, die er sich wünscht.
Das Ausmaß an erzwungenem Verzicht ist trotz der Krisenlawine der noch jungen 2020er Jahre einigermaßen überschaubar. Verzichtet wird in unseren Breitengraden zu einem häufig freiwillig*. Aber, wie gesagt, man lernt ihn hier kennen, den unfreiwilligen Verzicht. Es findet eine Verschiebung statt, was früher Selbstverwirklichung und Optimierung war, wird zur kollektiven Verpflichtung. Die Wahl zwischen Beef- und Veggiepatty wird zu einem kleinen Stein im Mosaik des Klimawandels; eine epidemiologisch unvorsichtige Entscheidung könnte letale Folgen haben. The stakes are high.
Vielleicht verlernen wir durch diese (ziemlich alternativlosen) „Verzichtserfahrungen“ ja auch, das Minimale zu sehr zu idealisieren, und das Mittelmaß, das Ausgeglichene, mehr zu schätzen. Ein großer Teil der Welt möchte echt nicht (noch) weniger. Unsere Anfälligkeit für Sätze wie weniger ist mehr zeigt vor allem eins: Wie verdammt viel wir eigentlich haben. Als Mantra für eine zunehmend ungemütliche Gegenwart und eine ungewisse Zukunft dürfte er sich aber dennoch gut eignen.
*Natürlich gibt es bei uns auch soziale Ungleichheit, natürlich gibt es auch (immer mehr) Menschen, die sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation zu Verzicht gezwungen sehen. Das möchte ich keinesfalls in Abrede stellen.